Wir freuen uns sehr, dass exzellente angewandte Forschung in einem Unternehmen mit dem Deutschen Zukunftspreis 2022 ausgezeichnet wurde. Im Interview mit Dr. Thomas Kalkbrenner diskutiert Forschungsmanager Dr. Christian Schunck, was die Erfolgsfaktoren und Hürden bei der Entwicklung der innovativen Technologie zur mikroskopischen Abbildung lebender Zellen waren.
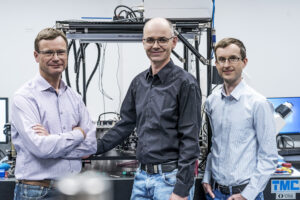
Können Sie zu Beginn kurz erklären, welche Herausforderungen die mit dem Zukunftspreis ausgezeichnete Innovation – ein Mikroskop mit dem Namen ZEISS Lattice Lightsheet 7 – löst?
ZEISS Lattice Lightsheet 7 wurde speziell für die Abbildung lebender Zellen entwickelt. Es handelt sich um ein Fluoreszenzmikroskopsystem. Diese Technologie ist aus den Lebenswissenschaften nicht mehr wegzudenken und wird weltweit in unzähligen Laboren eingesetzt. Das Problem ist aber, dass man, um diese so nützliche Fluoreszenz anzuregen, die Probe mit relativ intensiver Lichtstrahlung, meistens Laserstrahlung, beleuchten muss. In den letzten Dekaden ist immer deutlicher geworden, dass das die Zellen nachhaltig schädigen kann. Sie können dadurch sogar sterben. Und das ist natürlich besonders kritisch, wenn sich Forschungsergebnisse daran festmachen, dass die Zellen sich wie im natürlichen Umfeld verhalten. Das war der Ausgangspunkt, den wir bei dieser Entwicklung am Anfang hatten, sozusagen die Idee: Die Welt braucht ein Mikroskopsystem, bei dem die Zellen beim Beobachten nicht geschädigt werden. Wir wollten das entwickeln, auch wenn noch gar nicht klar war, wie das überhaupt funktionieren kann.
Wie lange war denn der Weg von dieser anfänglichen Idee bis zur Innovation?
Die Idee, wie ich sie gerade formuliert habe, war eigentlich mehr ein Wunsch. Das war etwa 2013. Seither sind tatsächlich zehn Jahre ins Land gegangen. Allerdings haben wir erste Systeme als Vorserie schon Ende 2019 an Kunden ausgeliefert. Es hat also etwa sieben Jahre gedauert, bis ein System auf dem Tisch stand.
Was waren die größten Hindernisse, die Sie dabei überwinden mussten?
In dem System stecken eigentlich drei Innovationen und damit waren auch drei größere Hindernisse zu überwinden. Zum einen mussten wir die Beleuchtungsstrategie eines herkömmlichen Mikroskops komplett neu denken. Die eingangs erwähnte Schädigung der Zellen durch die Laserstrahlung können wir natürlich nicht völlig verhindern, da wir die Moleküle in der Probe anregen müssen. Also mussten wir uns überlegen, wie man das Laserlicht so in die Zelle bringen kann, dass es möglichst wenig schädigt. Das war die eine große Herausforderung und das Ergebnis sind unter anderem die speziellen Lichtblätter, die sogenannten Lattice Lightsheets. Während diese Herausforderung durch die Physik bestimmt wird, kommt die zweite große Herausforderung vom Markt: wir wollten von Anfang an ein Mikroskopsystem bauen, das in jedem Standardlabor einsetzbar ist. Das bedeutet, dass standardisierte Probenträger, die in der biomedizinischen Forschung etabliert sind, verwendet werden müssen. Solche Probenträger, wie Petrischalen oder andere Zellkulturgefäße, haben einen Glasboden. Da muss man normalerweise von unten durchmikroskopieren. Richtig schwierig war, dass unsere Beleuchtungsstrategie, das Ergebnis der Überwindung der ersten Herausforderung, bedingt, dass unsere Optiken eben schief durch diesen Glasboden schauen müssen. Das war ein bis dato ungelöstes optisches Problem, weil dabei extreme Bildfehler auftreten.
Und die dritte Herausforderung war, aus diesen zwei Ansätzen und den neuen Technologien, die sich daraus ergaben, ein System zu machen, welches durch jeden bedienbar ist. Das ist ganz entscheidend, wenn wir möchten, dass das in Standardlaboren einsetzbar ist. Dann muss es von Nicht-Physikern und nicht speziell dafür ausgebildeten Menschen bedient werden können.
Man sieht, es ging nicht nur um eine wissenschaftliche Fragestellung, sondern wirklich darum, ein Produkt zu entwickeln.
Ja, das war wirklich wichtig. Wenn wir es nicht geschafft hätten, ohne spezielle Probenträger auszukommen, dann hätten wir immer noch ein tolles Mikroskopsystem. Aber es würde in einer Nische bleiben, in einer High-End-Nische der universitären Forschung für Leute, die sich darauf einlassen können und wollen. Gleiches gilt für die Bedienbarkeit.
Das hat also den potenziellen Impact bzw. die Möglichkeiten der Nutzung deutlich erhöht.
Auf jeden Fall.
Gab es in dem Entwicklungsprozess auch irgendwo einen Moment, wo Sie fast aufgegeben hätten?
Nur einen?
…oder mehrere solche Momente?
Ja, die gab es. Das war auch keine nur geradlinige Entwicklung, insbesondere für das Problem der schiefen Abbildung durch die Probengefäßböden. Dafür haben wir nicht die erste mögliche Lösung umgesetzt, sondern tatsächlich erst die dritte. Das war auch eine sehr spannende Phase für das Team. Es gab also Lösungen, die prinzipiell funktioniert hätten, bei denen wir uns aber aus verschiedensten Gründen entschieden haben, sie nicht umzusetzen. Bei der ersten Lösung haben wir nicht mal einen Demonstrator gebaut, weil wir schon früh gesehen hatten, dass das zu groß, zu komplex und potenziell zu teuer wird. Erst die dritte Lösung hatte dann das Potential, wirklich der Kern eines Systems zu werden, das in jedem Labor eingesetzt werden kann.
Als wir dann wirklich zum ersten Mal einen Demonstrator auf den Tisch gestellt haben, ging es darum, dass man das System überhaupt erstmal justiert bekommen muss, bis es das tut, was es tun soll. Dadurch, dass wir die etablierten Pfade der Mikroskopie an verschiedensten Stellen verlassen mussten, war eigentlich alles neu. Und ja, da gab es natürlich schon Tage und Wochen im Labor, an denen einfach erstmal nichts funktionierte. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann der Moment, in dem zum ersten Mal in dieser noch nie dagewesen Konfiguration echte, belastbare Bilder entstehen. Das war dann natürlich ein Highlight.
Wann gab es das erste Bild?
Das muss 2018 gewesen sein.
Und dann ging es schnell zum Kunden?
Ja, dann geht es natürlich auch gleich weiter, da wir sofort demonstrieren wollten und mussten, dass das zentrale Versprechen des Systems, nämlich diese ultimative Probenschonung, erfüllt wird. Das haben wir dann auch gesehen. Das war ganz, ganz wichtig für den Impact, auch innerhalb der Firma.
Man hatte sich das vorher zwar überlegt und die Gesetze der Physik haben eigentlich gezeigt, dass es so funktionieren muss, aber es ist trotzdem wichtig, dass man diesen Nachweis führen kann. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur eine Evolution ist. Es ist also nicht nur 20 Prozent oder 50 Prozent probenschonender als existierende Systeme, sondern es sind wirklich Größenordnungen, die dazwischen liegen. Das konnte man damals zum ersten Mal auch sehen, im direkten Vergleich.
Welche Rolle hat das Team bei dem Meistern von all diesen Herausforderungen gespielt?
Die größtmögliche! Das geht nicht ohne das Ineinandergreifen vieler Hände und Gehirne. Das war auch insofern eine sehr spannende Zeit, weil das Team sich in den unterschiedlichen Projektphasen durchaus unterschiedlich zusammengesetzt hat. Am Anfang waren sehr viel Theorie und Optikdesign erforderlich. Dann ging es irgendwann eher in die Labor- und Engineeringphase.
Wir waren immer ein vergleichsweises kleines Team und konnten dadurch sehr fokussiert an diesen Themen arbeiten. Die Motivation war sehr wichtig, aber auch dass wir immer viel Zeit darauf verwendet haben, zu erklären, was dort passiert und warum das so wichtig ist.
Wie war die Reaktion im Unternehmen auf ein System, bei dem alles neu gemacht wurde?
Wir haben versucht, vor allem die Produktion so früh wie möglich mit einzubinden. Wir haben zunächst eine kleine Vorserie aufgelegt und diese Systeme gemeinsam mit kreativen Tüftlern gebaut. Dabei haben wir alle erst den Umgang mit den neuen Technologien für die Serienfertigung gelernt und so ist die Keimzelle für die heutige Serienproduktion entstanden.
Und wie haben die Kunden reagiert?
Dieses System war nicht nur für uns als Firma in fast allen Belangen neu, sondern das war natürlich auch für die Anwender Neuland. Deshalb hatten wir eine Vorserie aufgelegt, die nur an ausgewählte Kunden gegangen ist, die sich darauf einlassen wollten. Die sind zunächst zu uns gekommen und haben sich den Demonstrator für einen Tag angeschaut und damit ihre mitgebrachten Proben mit uns gemeinsam untersucht. Dabei ist allen sofort klar geworden, dass das wirklich einen riesigen Unterschied macht. Allein den Wow-Effekt dieser Besuche ins Team mitzunehmen hat für sehr viel Motivation gesorgt.
Wie wichtig war die Kooperation mit externen Wissenschaftlern?
In diesem Fall waren das schon auch Kunden, also die Wissenschaftler haben für die Systeme bezahlt, und zwar nicht wenig. Insofern war auch das ein Beweis für den Impact, weil diese Wissenschaftler gesehen haben, dass das für ihre Forschung einen Unterschied macht und sie so überraschend schnell bereit waren, tief in die Tasche zu greifen, um Teil dieses Early Customer Programms zu werden. Wir haben in diesem Programm aber auch eng zusammengearbeitet, der Austausch ging in beide Richtungen. Das war auch für uns sehr wichtig, weil wir lernen und besser verstehen wollten, was unsere Kunden eigentlich mit diesem System tun und an welche Grenzen sie mit diesem ersten Wurf stoßen und was dann auch Weiterentwicklungen sein könnten, insbesondere im Bereich der Software.
Wir haben diese Plattform so konzipiert, dass wir zukünftige Weiterentwicklungen auf der gleichen Hardwareplattform durchführen können. Gerade zu diesem Softwareaspekt und der Bedienbarkeitsphilosophie gab es sehr viel Input von den Teilnehmern des Early Customer Programms. Das war für uns sehr nützlich.
Wo liegt der wesentliche Impact dieses Systems?
Im Moment liegt der Impact vor allem im Erkenntnisgewinn. Was wir im Zuge dieses Early Customer Programms deutlich gesehen haben, ist, dass damit Dinge nicht einfach nur besser gehen als früher, sondern dass Experimente möglich werden, die zuvor gar nicht möglich waren, und zwar in verschiedensten Bereichen, die schon heute absolut relevant sind, beispielsweise bei Infektionskrankheiten oder in der Krebsforschung.
Ein Großteil der Daten, die in vielen Präsentationen schon gezeigt wurden oder bei uns auf der Webseite zu sehen sind, stammen aus dem Early Customer Programm, wo Prozesse beobachtet werden konnten, die so zuvor noch nie beobachtet wurden.
Das wird sich in wirtschaftlichen Impact umwandeln, und zwar erstmal bei uns durch eine erhöhte Nachfrage nach diesen Systemen. Das ist natürlich wichtig, am Ende entwickeln und bauen wir Systeme, um sie zu verkaufen. In diesem Fall sind wir aber überzeugt, dass der Impact weit darüber hinausgehen wird. Durch die Fähigkeit, mit Standardprobegefäßen umzugehen, ist es eigentlich das einzige System dieser Art, das auch für die Pharmabranche interessant werden kann. Alle Prozesse dort drehen sich um Standardprobenträger, das kann nicht verändert werden. Es ist sehr spannend für uns zu versuchen, diesen Markt zu erschließen. Und daraus werden sich natürlich Erkenntnisse entwickeln, die dann wiederum für die Gesellschaft und dann auch auf einer breiteren wirtschaftlichen Basis relevant werden. Wenn darauf aufbauend zum Beispiel neue Wirkstoffe entstehen, dann wird das viel breitere Kreise ziehen als nur unsere Systemverkäufe.
Wie können wir in Deutschland aus Ihrer persönlichen Sicht eines Wissenschaftlers in einem Unternehmen den Impact in der angewandten Forschung weiter steigern?
Es gibt da eine Skepsis in der Medienlandschaft, ob es immer noch möglich ist auch in Deutschland innovative Produkte zum Erfolg zu bringen, die auch in Deutschland gefertigt werden. Eine kurze Nebenbemerkung sei erlaubt: die Wertschöpfungskette von diesem System liegt zum großen Teil in Deutschland, also auch die Zuliefererkomponenten. Ich denke, damit das möglich ist, braucht es einen gewissen Mut zur Innovation. Auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich habe ja schon umrissen, dass der Weg zum Produkt nicht immer direkt war. Für bahnbrechende, durchschlagende Innovationen mit Impact kann er das vielleicht auch gar nicht sein. Und das muss man sich aber erlauben, das muss man zulassen. Und da haben wir vielleicht auch bei ZEISS als Stiftungsunternehmen eine bessere Ausgangssituation als vielleicht ein börsennotiertes Unternehmen. Das kann auch eine Erkenntnis sein: wenn wir sowas erreichen wollen, dann muss man dafür sorgen, dass es auch an der einen oder anderen Stelle das Durchhaltevermögen gibt, dass auch Schleifen zugelassen werden. Was man dabei allerdings nie aus dem Auge verlieren darf, ist das Ziel. Wir haben uns beispielsweise die Systemeigenschaft der einfachen Anwendbarkeit mit allen gängigen Probenträgern fast schon als Dogma vorgegeben. Davon sind wir nicht abgerückt und das war wichtig, sonst hätten wir heute den Impact nicht.
War das auch wichtig für die interne Kommunikation, um die Unterstützung aufrechtzuerhalten?
Genau. Und da wiederum war es wichtig, dass wir im Entwicklungsprozess auch Zwischenmeilensteine hatten, wo man immer wieder zeigen kann, hier ist wieder eine Hürde genommen worden, die Perspektiven sehen immer noch gut aus. Auf der anderen Seite muss man auch immer wieder von der Marktseite und von der Kundenseite prüfen: sind die Anforderungen immer noch dieselben? Bei Entwicklungszeiträumen von mehreren Jahren kann sich auch mal von dieser Seite etwas verändern. Das muss man immer im Fokus behalten und gegebenenfalls nachjustieren.
Haben Sie auch externe Förderung erhalten oder wurde die Entwicklung rein intern finanziert?
Teile des optischen Systems wurden im Rahmen eines BMBF geförderten Verbundprojektes mit dem Akronym nanoSPIM (Schonende hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie lebender Zellen mit frei einstellbarem Lichtblatt) entwickelt.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage: Ihre Kollegen und Sie haben das Preisgeld gestiftet. Welchen Impact haben Sie damit beabsichtigt?
Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir das Preisgeld stiften wollen, und zwar für die naturwissenschaftliche Bildung und wenn möglich lokal. Wir haben hier in Jena ein schönes Projekt gefunden mit dem Deutschen Optischen Museum, das gerade am Entstehen ist. Dort wird ein Didaktikraum aufgebaut, in dem vormittags MINT-Lehrer, die Naturwissenschaftslehrer Thüringens, ausgebildet werden und nachmittags wird der Raum als Schülerlabor dienen. Und genau da gab es eine Finanzierungslücke, und das konnten wir dann übernehmen. Das ist eine sehr schöne Sache, weil wir überzeugt sind, dass für Innovationen die naturwissenschaftliche Bildung sehr wichtig ist. Da wird das Fundament gelegt für die Zukunftspreise von Übermorgen. Aber man darf dabei nicht nur auf diese Leuchtturmauszeichnungen schauen, so wichtig sie sind. Natürlich brauchen wir eine breite, solide naturwissenschaftliche Ausbildung, wenn wir als Hightech-Standort auch in Zukunft erfolgreich sein wollen. Das ist an dieser Stelle der Impact, den wir uns erhoffen. Und deswegen setzen wir dafür sehr gerne das Preisgeld ein.
Ich bin mir sicher, dass sich viele Lehrer, Schülerinnen und Schüler freuen werden.
Das hoffen wir!

